Interview | Nur wenige SAC-Hüttenwarte waren ihrem Arbeitsplatz so lange treu wie Luzius Kuster
«Ich vermisse die hochalpine Natur bei der Weisshornhütte»
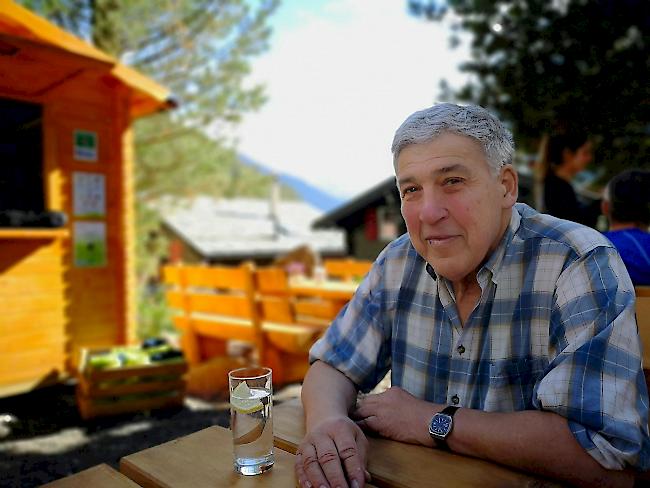
Tiefsinnig. «Wenn man sich am Berg befindet, weiss man nichts von all dem, was die Welt unten umtreibt. Das ist das Schöne», so Luzius Kuster.
Foto: Walliser Bote
Luzius Kuster (72) hat nach 50 Jahren als Hüttenwart der Weisshornhütte 2017 sein Amt schweren Herzens niedergelegt. Mit dem «Walliser Boten» redet er über den Spirit der Bergsteiger-Gilde, den Klimawandel, die Entwicklung des Rettungswesens und die veränderten Ansprüche an die Köche der SAC-Hütten.
«Die Weisshornhütte (2932 m ü. M.) ist nicht irgendein Refugium, sie ist die Bergunterkunft auf halber Wegstrecke vom tiefsten Tal der Alpen zum mächtigen, von überall sichtbaren, leuchtenden Weisshorn (4506 m ü. M.). Ein schützender Hort zwischen Berg und Tal, der nicht so recht weiss, ob er noch dem Bereiche des Lebens oder schon den unwirtlichen Regionen des ewigen Schnees angehört», beschreibt der Zermatter Schriftsteller Ernesto Perren auf dem Cover des Buches «Am Wege zur leuchtenden Pyramide» den Ort, an dem Luzius Kuster die Sommer der letzten 50 Jahre als Hüttenwart verbracht hat.
Luzius Kuster, nach einem halben Jahrhundert haben Sie diesen Sommer im Tal verbracht. Fehlt Ihnen das Hüttenleben?
«Der Aufenthalt im Tal während des Sommers kam mir komisch vor. Ich vermisse das Hüttenleben immer noch. Mir fehlt die andere, die hochalpine Natur. Im Tal ist es auch nett. In diesem Sommer aber machte mir die Hitze zu schaffen. Das war ja auch mit ein Grund, weshalb ich so lange als Hüttenwart arbeitete.»
Im Sommer 2018 haben Sie die Hütte gar nicht mehr besucht?
«Doch. Ich habe Jacqueline und Hans-Peter Berchtold, das neue Pächterpaar, an drei Tagen in die Begebenheiten der Weisshornhütte eingeführt. Das wars dann.»
Stimmt die Redensart, dass der Aufenthalt im Gebirge manche Sorge und manches Problem, die man im Alltag mit sich trägt, vergessen macht?
«Wenn man sich am Berg befindet, weiss man nichts von all dem, was die Welt unten umtreibt. Das ist das Schöne. Auf der Hütte kannst du alles vergessen. Man erhält keine Post, es gibt kein Fernsehen, man hört höchstens mal die Nachrichten, welche die Musik unterbrechen. Dort, wo sie sich die Köpfe einschlagen, sollen sie das tun. Du aber bist oben, inmitten dieser speziellen Welt.»
Zurück zum Anfang. Wie kommt man als gebürtiger St. Galler, der seine Kindheit und Lehrjahre in Basel verbrachte, zu einem Job als Hüttenwart in den Walliser Alpen?
«Ab dem Jahr 1955 verbrachte ich Jahr für Jahr zusammen mit meinen Eltern und den drei Geschwistern die Sommerferien in Randa. Von dort aus unternahmen wir regelmässig Wandertouren in die Berge. Seilbahnen gab es zu der Zeit noch nicht viele. Mit acht Jahren stand ich auf dem Breithorn auf 4164 Meter, mit elf auf dem Alphubel auf 4206 Meter.»
Und wann arbeiteten Sie zum ersten Mal auf der Weisshornhütte?
«Mit 19 Jahren. Ich war Mitglied der Jugendorganisation des SAC Basel, der Besitzerin der Weisshornhütte. So kam es, dass ich im Sommer 1966 zusammen mit den Söhnen des damaligen Hüttenwarts Kamil Summermatter auf der Hütte aushalf. Auf Sommer 1967 suchte der SAC einen neuen Hüttenwart. Bis im Frühjahr hatte die Sektion noch keinen Nachfolger gefunden. So hatte ich mich angeboten, für eine Saison die Hütte zu übernehmen. Ich hatte gerade die Lehre als Tiefbauzeichner in Basel beendet und die Rekrutenschule hinter mir und schon einige gute Kontakte zu Jugendlichen in Randa. Nach Ende der Hüttensaison 1967 entschloss ich mich, nicht mehr nach Basel zurückzukehren.»
Als Hüttenwart konnten Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten?
«Nein, natürlich nicht. Die Saison auf der Hütte dauert nur zwei Monate. Im Winter arbeitete ich 35 Jahre lang bei der Gornergrat Bahn, nach der Fusion bei den Bergbahnen Zermatt. Im Frühling und Herbst fand ich Arbeit in einem Vermessungsbüro in Visp. Reich wird man nicht als Hüttenwart, dafür entlohnte mich die Natur reichlich.»
Welches Land stellt die meisten Weisshorn-Besteiger?
«Zu Beginn meiner Tätigkeit waren es prozentual am meisten deutsche Alpinisten, später hielten sich Schweizer und Deutsche die Waage. Mit verbesserter Wirtschaftslage sind heute die Schweizer wieder im Vormarsch.»
Wie viele Übernachtungen verzeichnet die Hütte?
«In einer Saison waren es einmal rund 1000. Es gab aber auch solche, wo kaum 200 Bergsteiger auf der Hütte übernachteten. Im Schnitt waren es um die 600 Gäste.»
Wie oft standen Sie auf dem Weisshorn?
«Dreimal. Erstmals 1966.»
1974 wurde die Weisshornhütte von 20 auf 30 Plätze erweitert. Weshalb?
«Ich stellte fest, dass die Frequenzen auf der Hütte stetig stiegen, also machte ich ein Vorprojekt, auf das der SAC Basel einstieg. Anschliessend übernahm ich die Leitung des Erweiterungsbaus nach den Plänen eines Architekten. Zu Beginn der Arbeiten überraschte uns am 24./25. September 1974 ein früher Wintereinbruch mit über einem Meter Neuschnee, sodass wir erst im Frühsommer 1975 fortfahren konnten.»
Bergsteiger stellen heute an die Verpflegung einer Hütte höhere Ansprüche als früher. Was hatte der Koch zu Ihren Anfangszeiten für Aufgaben?
«Dazumal wurde in einem einzigen Raum gekocht, gegessen und geschlafen. Das war üblich. Jeder Alpinist brachte sein Päckchen Suppe, sein Wienerli, seinen Teebeutel und ein bisschen Zucker mit. Der Hüttenwart hat das Mitgebrachte zubereitet und konnte dafür ein Entgelt verlangen. Das hat sich völlig verändert: Heute erwarten Hüttengäste zu 95 Prozent ein Nachtessen und ein Frühstück, das vom Hüttenwart aus dessen Küche serviert wird.»
Mit Beginn Ihrer Tätigkeit nahm auch die Air Zermatt ihren Betrieb auf. Was bedeutete das für Sie?
«Viel. Bis dahin mussten der Proviant und das Feuerholz zur Hütte von Randa in einem vierstündigen Marsch hochgetragen werden. Ab 1967 übernahm diese mühselige Arbeit ein Heli vom Standort Täsch, später von Zermatt aus.»
Wie gestalteten sich Bergrettungen im ersten Hüttenjahr?
«In jenem Sommer stürzte ein Schweizer Alpinist die Nordostwand des Weisshorns hinunter. Sein Bergkamerad stieg zur Hütte herunter, um das Unglück zu melden. Jemand stieg ins Tal hinunter, um Retter anzufordern. Anderntags landete Gletscherpilot Hermann Geiger mit seiner Piper mit einer Rettungskolonne der SAC-Sektion Tessin auf dem Bisgletscher. Der Verunglückte wurde nicht gefunden. Er gilt bis heute als verschollen.»
Ab 1968 flog auch die Air Zermatt Rettungseinsätze. Können Sie sich an deren ersten Einsatz am Weisshorn erinnern?
«Ein Bergsteiger zog sich bei Kletterübungen oberhalb der Hütte schwere Verletzungen zu. Wir transportierten ihn mit einem Schlitten zur Hütte. Anschliessend rannte ich in 45 Minuten hinunter nach Randa, um telefonisch den Heli in Täsch anzufordern, denn auf der Hütte gab es erst ab dem Jahr 1970 ein Telefon. Der Mann ist ins Spital geflogen worden.»
Im Zeitalter von Smartphones sind Flugretter heute meist wenige Minuten nach Bergunglücken alarmiert. Bekommt ein Hüttenwart ein Unglück am «eigenen Berg» überhaupt noch mit?
«Meistens nicht. Die Notrufe werden über die 144 abgesetzt und Hilfe auch von dort aus organisiert, sodass wir oft erst viel später von einem Unglück erfahren. Die Bergretter arbeiten heute in faszinierender Weise hoch professionell.»
Wie hat sich Bergsteigen in den letzten 50 Jahren aus Ihrer Sicht entwickelt?
«Früher hatte man weniger Geld für Equipment und auch weniger Angebote. Heute hat jeder Bergsteiger das Beste, was der Markt anbietet. Gott sei Dank! Weniger für uns Mitteleuropäer, als vielmehr für die Bergsteiger aus den Oststaaten. Diese reisten in den 1960er-Jahren mit Turnschuhen oder kaputten Bergschuhen und schlechten Seilen an. Dies hat sich heute sehr zum Positiven verändert. Generell hat bessere Ausrüstung zu weniger Bergunfällen beigetragen.»
Gab es auch einen Mentalitätswandel bei den Alpinisten?
«Dazumal wie auch heute steht beim Bergsteiger das Naturerlebnis im Vordergrund. Auch bei schlechtem Wetter stiegen die Bergführer früher mit ihren Gästen zur Hütte hoch. Liessen die Bedingungen anderntags keine Tour zu, stieg man einfach wieder ab. Das wars.»
Dieser Spirit lebt nicht mehr?
«Bei vielen Bergsteigern ist die Besteigung eines Berges heute ein Abhaken eines bislang nicht erklommenen Gipfels. Gleichzeitig stehen sie oftmals unter Stress, weil sie nur über ein kleines Zeitfenster verfügen. Zur Hütte steigen sie deshalb nur mehr hoch, wenn die Wetterprognosen anderntags eine Tour erlauben. Sonst reisen sie noch gleichentags ab.»
Alle Welt spricht von Klimawandel, welche Veränderungen konnten Sie im Verlaufe der Jahre feststellen?
«Das Abschmelzen der Gletscher ist brutal. Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte sind auch die Gletscherzungen in der Region ums Weisshorn um Hunderte Meter weggeschmolzen. Das macht sich auch in der Hütte bemerkbar. Die Leitung der Wasserversorgung muss in höhere Lagen verlängert werden, weil die jetzige Fassung gegen Ende der Hüttensaison manchmal austrocknet. Der Klimawandel lässt sich auch an Veränderungen der Flora ablesen. Hochalpine Blumen, die früher nur unterhalb der Hütte blühten, sind heute gut 200 Höhenmeter weiter oben zu beobachten. Ein untrügliches Zeichen, dass sich das Klima erwärmt.»
Norbert Zengaffinen












Artikel
Kommentare
Noch kein Kommentar