Welterbe-Wasserforum Naters
Klimawandel: Schneefallgrenze steigt um 500 Meter
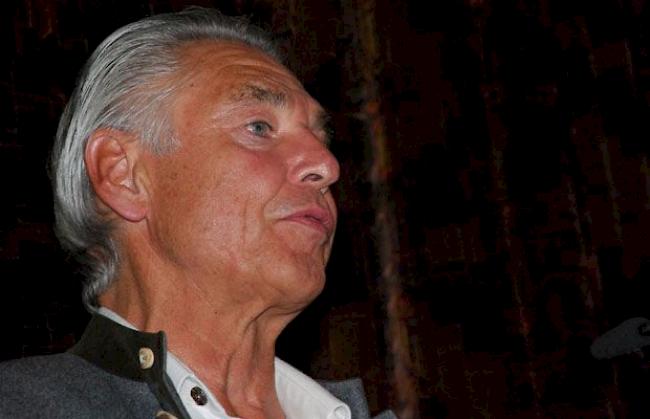
Nestlé-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck-Letmathe unterstrich dies in seinem Referat deutlich: «Wasser ist das wichtigste Rohmaterial das wir auf der Welt haben».
Foto: zvg

Der Walliser Volkswirtschaftsdirektor Jean-Michel Cina war beim Welterbe-Wasserforum ebenfalls anwesend.
Foto: zvg
Der Klimawandel hat grossen Einfluss auf die Walliser Gletscherlandschaft und die zukünftigen Abflussmengen der Wasserläufe, wie Experten am Welterbe-Forum am Freitag in Naters darlegten.
Vom 30. September bis 5. Oktober 2013 führt das Management Zentrum des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch die 1. Welterbe-Woche durch. Highlight dieser Woche war unbestritten das Welterbe-Wasserforum, das am 4. Oktober im Zentrum Missione in Naters über die Bühne ging.
Das Managementzentrum des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch verfolgt mit der Welterbe-Woche «Wasser & Geist» das Ziel, die Bevölkerung für das Thema Wasser zu sensibilisieren und den Wert des Wassers und die Bedeutung der Wassereffizienz aufzuzeigen. Dies auch aus der Optik, da die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UNO) im Jahr 2013 zu mehr «Zusammenarbeit im Bereich des Wassers» aufgerufen hat.
Den Höhepunkt dieser Woche bildete das Welterbe-Wasser-Forum, an dem die Ressource Wasser als kostbares Gut und als Rohstoff in seiner regionalen und globalen Bedeutung durchleuchtet wird. Nestlé-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck-Letmathe unterstrich dies in seinem Referat deutlich: «Wasser ist das wichtigste Rohmaterial das wir auf der Welt haben». Die Referenten am Welterbe-Wasser-Forum waren sich einig: Wasser wird auch in der Welterbe-Region in Zukunft knapper.
Das Herzstück des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch ist der Grosse Aletschgletscher. Gemäss Gletschermodellierungen, die innerhalb des Projekts Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz (CCHydro) des Bundesamts für Umwelt durchgeführt wurden, wird er sich bis Ende Jahrhundert auf 3000 m ü.M. zurückziehen und noch 10 Prozent des heutigen Volumens ausmachen.
Doch der Schwund bietet auch Chancen. Durch den Rückzug des Gletschers entstehen viele Gletscherseen. Diese arktisch anmutenden Seenlandschaften sind eine grosse Chance für den Tourismus in der Aletschregion.
Doch nicht nur die Gletscherlandschaft verändert sich. Mit der prognostizierten Temperaturerhöhung in den nächsten Jahrzehnten nehmen die in den Alpen gespeicherten Schnee- und Eismassen stark ab. Dr. David Volken, Gletscher- und Hochwasserexperte beim Bundesamt für Umwelt, sagt dazu: «Mit der Temperaturerhöhung findet ein Anstieg der Schneefallgrenze um 500 m bis ins Jahr 2100 statt. Die Dauer der Schneedecke nimmt bis Ende Jahrhundert um ca. 40 Prozent ab.» Durch die abnehmenden Schnee- und Eisreserven in den Alpen und einer saisonalen Umverteilung des Niederschlags (weniger Niederschlag im Sommer, mehr Niederschlag im Winter) wird sich das Abflussregime der Schweiz verändern.
Dadurch wird sich die jahreszeitliche Verteilung der Abflüsse langfristig verschieben. Im Winter gibt es in vielen Gebieten deutlich mehr Abfluss, im Sommer vermindern sich die Abflüsse. Eine Ausnahme stellen stark vergletscherte Regionen wie die Aletschregion dar, wo bis Mitte Jahrhundert die Abflüsse aufgrund der Eisschmelze im Sommer noch zunehmen. Durch diese Entwicklung verschiebt und verlängert sich die potentielle Hochwasserzeit in den Alpen. Niedrigwasserperioden werden länger und die Abflüsse nehmen im Mittelland im Sommer deutlich ab. In den Alpen verschiebt sich die Niedrigwasserzeit vom Winter teilweise in den Spätsommer.
Was bedeutet das für unsere Region?
Die saisonale Umverteilung des Wasserangebots wird in Zukunft zu räumlich sowie zeitlich auftretenden Problemen und dementsprechend zu Konfliktsituationen führen, wie der Hitzesommer 2003 bereits gezeigt hat. Der Hydrologie-Professor Rolf Weingartner sagt dazu: «Deshalb muss in Zukunft die Wasserverfügbarkeit den saisonalen Veränderungen angeglichen werden, beispielsweise durch den Ausbau bestehender Wasserspeicher in den Alpen, die zudem einer Mehrzwecknutzung überführt werden sollten. Regionale Entwicklungsplanung, ein regionales Wassermangement und eine regionale Vernetzung der Wasserversorgung sind Schlüsselgössen, um gezielt und nachhaltig auf die künftigen Herausforderungen zu reagieren.»
In einem wärmer und trockener werdenden Europa wird die Wasserschlossfunktion der Schweiz in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Wenn sich Hitzesommer wie 2003 häufen, dürfte dies zunehmende Begehrlichkeiten benachbarter trockener werdender Regionen wecken. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Wasserverteilung besonders auch für trockenere Perioden zu planen: Neben der Deckung der Grundbedürfnisse (Trinkwasser) gilt es, die Ansprüche verschiedener Nutzergruppen wie Landwirtschaft, Energieerzeugung und Tourismus zu berücksichtigen. Dies wird gezwungenermassen ein Umdenken bei der Wassernutzung mit sich bringen und letztlich für verstärkte Kooperationen sorgen.
Die Welterbe-Region kann hier eine Vorbildfunktion übernehmen: Frühzeitig und beispielhaft ein gemeinde- und kantonsübergreifendes Wassermanagement entwickeln, um die Wassereffizienz zu steigern, nachhaltige Entwicklungsszenarien zu identifizieren und Handlungsoptionen ins Auge zu fassen.
Lösungsansätze für die Zukunft
Durch die in Zukunft zunehmenden und tendenziell grösseren Hochwasser müssen die bestehenden Hochwasserschutzmassnahmen im Mittelland und Jura überprüft werden. Die ausgeprägteren Niedrigwasser und ein gleichzeitig grössere Wasserbedarf während der wärmeren und trockeneren Sommer bergen ein Konfliktpotential unter den verschiedenen Nutzern. Die rechtlichen Regelungen in verschiedenen Bereichen (Wasserentnahmen, Einleitung von Kühlwasser, usw.) müssen überprüft werden.
Die Landwirtschaft kann einerseits den Boden so bewirtschaften, dass er das Wasser besser zurückhält und speichert. Andererseits kann sie ihren Wasserbedarf verringern, indem sie Bewässerungssysteme optimiert und indem sie Sorten anbaut, die weniger Wasser benötigen. Der Energiesektor kann Einschränkungen in der Wasserkraftproduktion begegnen, indem er das verbleibende Potenzial effizient nutzt und sich vermehrt auf zusätzliche erneuerbare Energiequellen abstützt.
Es braucht zur Optimierung neue Konzepte zur Wasserspeicherung und -verteilung. Im Vordergrund stehen die Nutzung von natürlichen Speichern wie Seen, die Mehrzwecknutzung von Speicherseen, die Anpassung von Seeregulierungen, der Bau von Wasserspeichern für Bewässerungszwecke sowie die Optimierung der Verteilsysteme. Dabei sind auch die Bedürfnisse der Nachbarländer zu berücksichtigen.













Artikel
Kommentare
Noch kein Kommentar